Les Vitrines ist ein Ausstellungsraum, der der französischen Kunstszene gewidmet ist und vom Büro für bildende Kunst des Institut français Deutschland sowie vom Institut français Berlin eingerichtet wurde. In diesem Jahr übernimmt die Kuratorin Lisa Colin die künstlerische Leitung, das Studio Kiösk die visuelle Gestaltung.
Neue Sprachen
In diesem Jahr lädt der Ausstellungsraum Les Vitrines nacheinander die Künstler Arthur Gillet und Lou Masduraud ein, sich an einer romantischen Revolution zu beteiligen. Von Seidenmalerei bis hin zum Patinieren von Bronze geben sie mit ihren einzigartigen und sorgfältigen Methoden den traditionellen Fertigkeiten einen neuen Anstrich und bringen wunderbare Welten zum Vorschein, die bislang verborgen waren. Die eigens zu diesem Anlass geschaffenen Fresken erheben das lange Währende, die Verflechtung und die Wiederentdeckung der Seide und des Hörens zu unverzichtbaren Triebkräften für den Wiederaufbau einer gemeinsamen Welt.
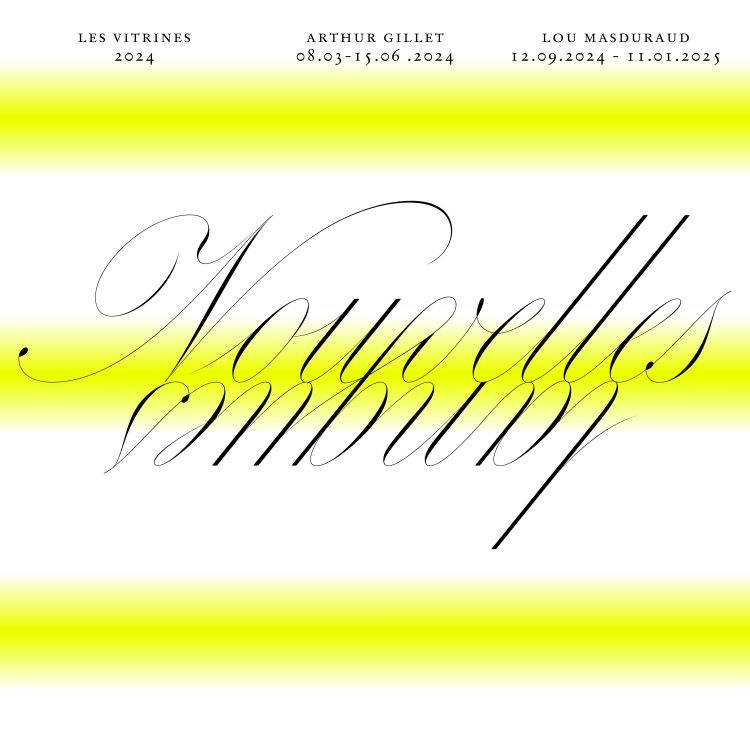
Arthur Gillet, All das, wovon ihr ihr noch nie gehört habt
08.03. – 15.06.2024
Vernissage am Donnerstag, den 8. März 2024 um 19 Uhr und Performance von Arthur Gillet um 20 Uhr, Eintritt frei
Mit einer Seidenmalerei von 25 Metern Länge zeichnet Arthur Gillet seinen Werdegang nach, wissend um seine Schwierigkeit, sich an die Welt und andere anzupassen. Dieses persönliche und zugleich universelle Fresko zeugt vom Leben eines CODA – Child of Deaf Adults [hörendes Kind von gehörlosen Eltern] und offenbart oft unterschätzte Aspekte des Lebens von Gehörlosen und soziokulturelle Herausforderungen, die mit diesem Anderssein einhergehen. Mit einer Gruppe von Figuren überwindet das Werk die Sprachbarrieren und erkundet die Feinheiten der nonverbalen Kommunikation.
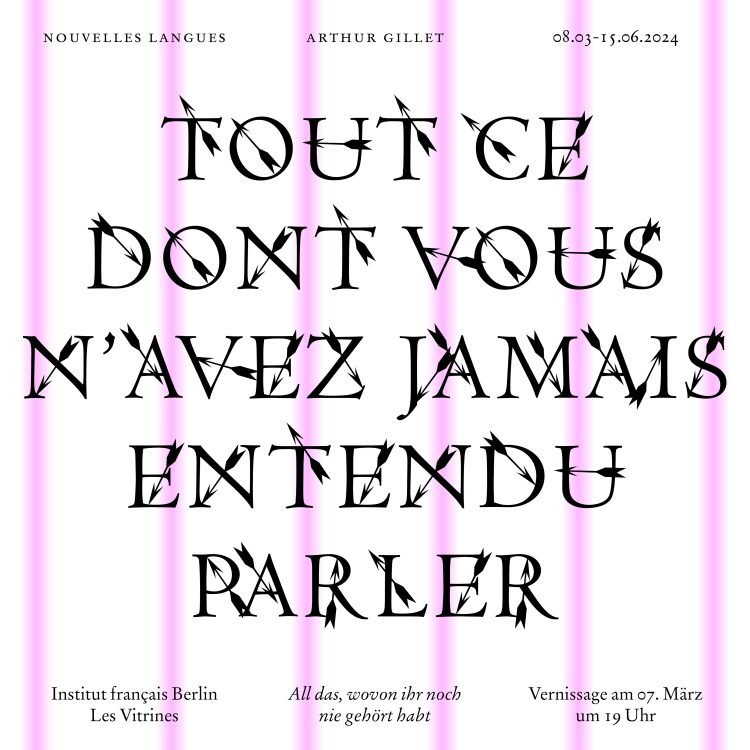
Mit einem Pfeil, der das Ohr von Arthurs Mutter durchbohrt, erinnert die Malerei an deren Hörverlust und an die Lebensabschnitte, die daraus folgten: ihre Erziehung im Kloster, wo man ihr verbot, sich in Gebärdensprache auszudrücken, ihre Beteiligung am Réveil Sourd („Erwachen der Gehörlosen“), einer Bewegung, die sich für die Rehabilitierung der französischen Gebärdensprache einsetzte, die Geburt von Arthur und seine schwierige Eingliederung in eine Welt zwischen Gehörlosen und Hörenden, die soziale Isolation, die Hänseleien und die Gewalt aufgrund des Andersseins, ehe beide, Mutter und Sohn, durch die neuen Technologien eine Form der Emanzipation fanden. Arthur Gillet ließ sich dabei von den Buchmalereien von Cristoforo de Predis inspirieren, einem gehörlosen Künstler des italienischen Mittelalters, insbesondere was die Verwendung von kräftigen Farben und die Darstellung von symbolischen Strukturen betrifft: Architektonische Elemente – Inklusorien, Kirchen, Tore, Türme – sind für die dargestellten Figuren, die von unsichtbaren Wesen geleitet werden, gleichermaßen Orte der Isolation und des Übergangs. Die Ikonographie offenbart die oft verschleierte Rolle der Religion in der Geschichte der Gehörlosen, in der die Gleichsetzung von Gehörlosigkeit mit geistiger Behinderung zum Wegsperren und zur Stigmatisierung der Betroffenen geführt hat. Die figurative Darstellung, eine Kunst, die bereits in den Kirchen zur Vermittlung des Inhalts eines Buches an eine analphabetische Bevölkerung angewandt wurde, beschränkte sich jedoch nicht auf einen rein pädagogischen oder schmückenden Aspekt. Die Fresken von Fra Angelico im Kloster San Marco waren als Stütze für den inneren Dialog gedacht. In der Kultur der Gehörlosen und der CODA ist die Überzeugung entstanden, dass das Bild über eine westliche (platonische, christliche oder moderne) Dialektik hinaus nicht das Substitut einer ihm überlegenen intellektuellen Wahrheit ist, sondern eine eigenständige, bedeutungsvolle und facettenreiche Ausdrucksform, die die Grenzen des gesprochenen Wortes überwindet.

Gehörlos oder CODA zu sein war dennoch bis 2005 gleichbedeutend damit, keine Muttersprache zu haben. Beim Mailänder Kongress von 1880 kamen 225 „Spezialisten“ zusammen, darunter nur drei Gehörlose, und fassten den Beschluss, die gesprochene Sprache auf Kosten der Gebärdensprachen zu fördern. Die Gebärdensprachen blieben bis 1991 verboten[1], ehe sie im Laufe der 2000er Jahre (in Frankreich im Jahr 2005) nach und nach in Europa als offizielle Sprachen anerkannt wurden. Der Oralismus verlangte von gehörlosen Menschen eine erzwungene Integration durch Nachahmung unter Anwendung von schmerzhaften und verstümmelnden Methoden (Apparate, Trepanationen). Er war Teil einer Pädagogik, die vorgab, dass man hören und sprechen können muss, ehe man schreiben lernen kann, und wertete die Fähigkeiten und die Intelligenz ab, die bei jedem Menschen individuell ausgeprägt sind. Mit ihm entwickelten sich Methoden des erzwungenen Lernens, nach dem Motto: Dieses Kind wird genau wie die anderen sein: Es wird hören und es wird sprechen[2]. Folglich herrschte 2003 in Frankreich unter den zwei Millionen von Geburt an gehörlosen Menschen ein massiver Analphabetismus von 80 %[3]. Dies betrifft auch die Mutter von Arthur, die 1971 den einzigen für sie realisierbaren Abschluss erlangte, einen Befähigungsnachweis in Hauswirtschaft. In den 70er und 80er Jahren beteiligte sie sich an der Bewegung Réveil Sourd, die sich im Schulterschluss mit den organisierten Kämpfen von Feminist*innen, Antirassist*innen, LGBTQ-Aktivist*innen und Kolonialismusgegner*innen, die für ihre Anerkennung und ihre Rechte eintraten, für eine zweisprachige Erziehung von gehörlosen Kindern stark machte. Durch diese Begegnung mit anderen Gehörlosen erlernte Arthurs Mutter im Alter von 17 Jahren ihre „natürliche Sprache“, die Gebärdensprache.
Indem er bisweilen traumatische Begebenheiten noch einmal abruft, macht Arthur Gillet wenig bekannte soziopolitische Zustände sichtbar und schafft Aufmerksamkeit für die häufig erfolgende Parentifizierung: Den CODA wird dabei die Rolle als Vermittler oder Elternteil im Kontakt mit einer in vielen Bereichen (Arbeitssuche, Übersetzung, Sozialisierung, Integration) ableistischen Gesellschaft von Hörenden auferlegt. Der Künstler stellt den bedeutenden Einfluss der technologischen Entwicklungen wie die Erfindung des Minitel-Systems, des Telefons, der Funk-Blitzlampe Lisa (die Töne als Lichtsignale wiedergibt) oder des Teletexts Antiope (für die Live-Transkription von Dialog und Ton aus Filmen, dargestellt mit einem Farbcode) heraus, die nicht nur die Kommunikation und soziale Integration erleichtert, sondern vor allem auch dazu beigetragen haben, dass gehörlose Personen selbstständiger leben können. In seinem Fresko entwickelt er eine vielschichtige Ikonographie des Unsichtbaren, in der die Technologie die Religion in den Hintergrund drängt: Die Engel werden durch verkündende Bildschirme ersetzt, der Glockenturm der Kirche durch einen Sendemast und die Heiligenstrahlen sind Funkwellen. Das 21. Jahrhundert wird damit zum Zeitalter der Magie, Dinge geschehen, ohne dass man ihre Funktionsweise versteht. Nach dem Vorbild von Hilma af Klint[4], deren Aufzeichnungen und Bilder vom Spiritismus geprägt sind, ist das Werk von Arthur Gillet ein Portal zu anderen Dimensionen, in denen Realität und Fantasie gleichsam existieren. Die Verwendung der figurativen Darstellung macht eine physische Kondition sichtbar, die es sonst nicht ist, und wirkt so deren „Monstrosität“, d. h. eben jener fehlenden Wahrnehmbarkeit, entgegen. Die neuen Technologien haben der Bewegung ebenfalls eine hohe Sichtbarkeit verschafft, eine selbstverwaltete politische Repräsentation nach dem Beispiel anderer Minderheiten.
Das von hinten beleuchtete Fresko nimmt Züge von Kirchenfenstern oder einer Leinwand an und folgt dem Ablauf eines Kinofilms: Wer an dem Ausstellungsraum vorbeigeht, entdeckt eine Abfolge von Bildern, die als stumme Zeugen des Lebens eines CODA zum Leben erwachen. Zwischen dem Anspruch, genau „wie die anderen“ zu sein und jenem, in seiner Besonderheit anerkannt zu werden, löst Arthur Gillet die Stereotype auf und stellt die Gehörlosigkeit nicht als ein Unvermögen dar, sondern als einen Unterschied auf körperlicher, intellektueller und emotionaler Ebene. All das, wovon ihr noch nie gehört habt ist ein visuelles Manifest; das ergreifende Zeugnis eines Kampfes für Inklusion und die Anerkennung der Gehörlosenkultur.
Lisa Colin
[1] Ab 1975 lehrten in der Île-de-France Vereine wie das IVT – International Visual Theatre die französische Gebärdensprache. Erst mit der „Fabius“-Gesetzesnovellierung von 1991 wurde den Familien das Recht zugesprochen, einen zweisprachigen Unterricht für ihre Kinder zu wählen. Dieses Dekret wurde jedoch kaum beachtet, sodass in der Folge lediglich 1 % der gehörlosen Schülerinnen und Schüler Zugang zu diesen Strukturen hatte.
[2] Marcelle Charpentier, Cet enfant sera comme les autres : il entendra, il parlera. Dès l’âge de la maternelle (Éditions sociales françaises, Paris, 1956).
[3] Brigitte Parraud und Carole Roudeix, „Bibliothèque, lecture et surdité“, BBF – Bulletin des bibliothèques de France (online abrufbar, 2004).
[4] Schwedische Malerin (1862-1944), die ihr Leben und ihre Arbeit der Erforschung des Unsichtbaren gewidmet hat
Arthur Gillet (geb. 1986, lebt und arbeitet in Paris) ist ein bildender Künstler und Performance-Künstler. Parallel zu seinem Studium an der École des beaux-arts de Rennes absolvierte er eine Ausbildung in zeitgenössischem Tanz im Musée de la danse. Er wuchs begleitet vom Prozess der geschlechtlichen Transition in einer gehörlosen und neurodiversen Familie auf, die vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt war. In seinem Werk vertieft Arthur Gillet die Themen Verlangen, Identität, sozialer Kampf und Medien; mit seiner Performance‑ und Happening-Kunst besetzt er öffentliche und institutionelle Räume. Er ist geprägt von Autorinnen und Künstlerinnen, die seine geschlechtliche Transition begleitet haben: Naoko Takeuchi, Jane Austen, Valtesse de la Bigne, Virginia Woolf, Murasaki Shikibu, Isabelle Queval, Geneviève Fraisse, Elisabeth Lebovici. Seine Arbeit hat Arthur Gillet sowohl in Frankreich als auch im Ausland präsentiert, unter anderem im CAC Brétigny, im Palais de Tokyo (Paris), in der PROXYCO Gallery (New York) und im Transpalette – Centre d’art contemporain de Bourges.
Website: https://arthurgillet.com/
Instagram: @arthurouge





Fotocredits: Kathleen Pracht
Kiösk ist ein Grafikdesignstudio mit Sitz in Ivry-sur-Seine. Das Duo, bestehend aus Elsa Aupetit und Martin Plagnol, entwirft visuelle Identitäten, Websites, Plakate, Editionen und Beschilderungen im Rahmen von öffentlichen und privaten Aufträgen. Sie haben außerdem den unabhängigen Verlag Dumpling Books gegründet.
Instagram : @studio_kiosk


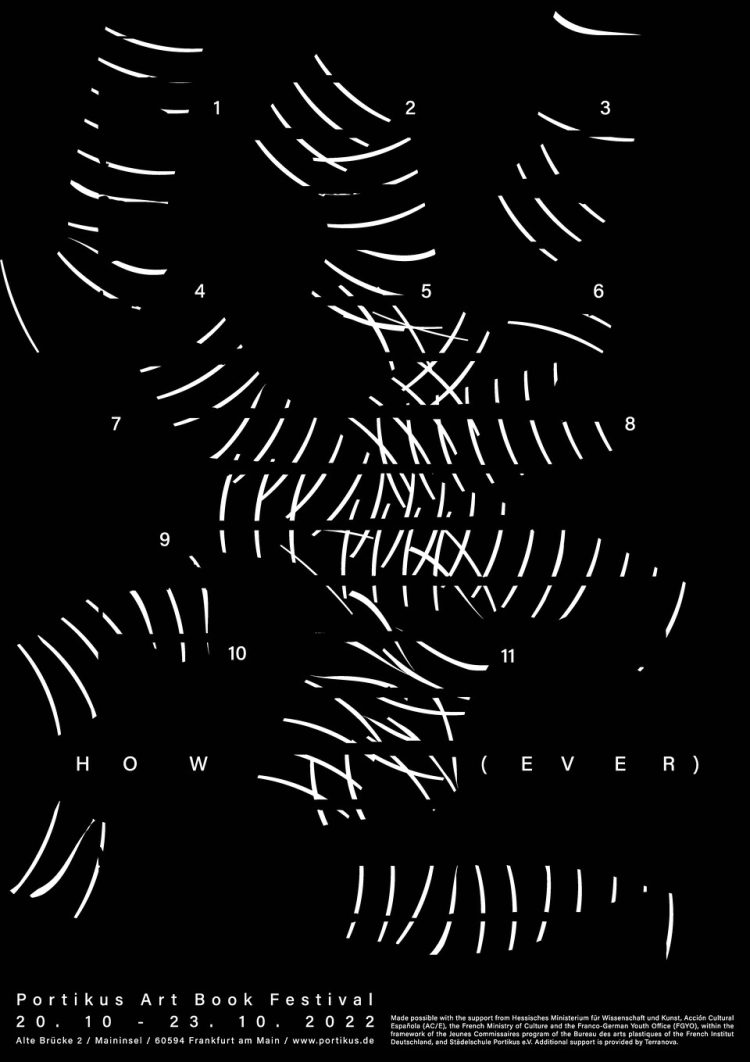










 Der von Anne-Laure Lestage für „Les Vitrines 2022“ erdachte Vorschlag lädt das ganze Jahr über und durch drei Ausstellungen französische Künstlerinnen und Künstler ein, die in ihrer solo oder duo Praxis auf erweiterte Weise über das wilde Schreiben nachdenken. Der gleichnamige Titel von Mallarmés Hirtengedicht und Nijinskis bestialischer Choreographie, Nachmittag eines Faunes, preist eine Kreatur, halb Mensch, halb Tier, die ihrem Verlangen nachjagt. Durch freie und intuitive Formen offenbaren die Künstler auf zerbrechliche, sanfte und brutale Weise die Andersartigkeiten zwischen den lebenden Welten. Dieses ländliche Präludium findet sich hier an einer Berliner Straßenkreuzung wieder, wie eine Ruderalpflanze, die zwischen den Rissen im Zement wächst. Mensch und Tier, häuslich und instinktiv sind durch ein Spiel mit zweideutigen Darstellungen, Gesten und Materialien miteinander verwoben. „Les Vitrines“ versuchen, über die Frage der Wildnis nachzudenken.
Der von Anne-Laure Lestage für „Les Vitrines 2022“ erdachte Vorschlag lädt das ganze Jahr über und durch drei Ausstellungen französische Künstlerinnen und Künstler ein, die in ihrer solo oder duo Praxis auf erweiterte Weise über das wilde Schreiben nachdenken. Der gleichnamige Titel von Mallarmés Hirtengedicht und Nijinskis bestialischer Choreographie, Nachmittag eines Faunes, preist eine Kreatur, halb Mensch, halb Tier, die ihrem Verlangen nachjagt. Durch freie und intuitive Formen offenbaren die Künstler auf zerbrechliche, sanfte und brutale Weise die Andersartigkeiten zwischen den lebenden Welten. Dieses ländliche Präludium findet sich hier an einer Berliner Straßenkreuzung wieder, wie eine Ruderalpflanze, die zwischen den Rissen im Zement wächst. Mensch und Tier, häuslich und instinktiv sind durch ein Spiel mit zweideutigen Darstellungen, Gesten und Materialien miteinander verwoben. „Les Vitrines“ versuchen, über die Frage der Wildnis nachzudenken.






